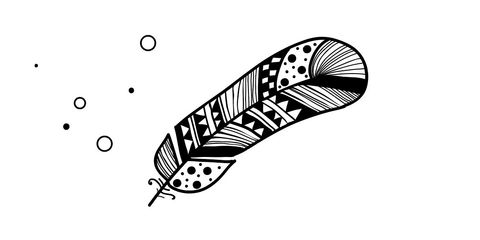Heute geht es um Fledermausbehausungen. Wir sind gerade noch in der richtigen Zeit, um ein paar Kästen aufzuhängen oder Schlupflöcher für den Winter zu schaffen (was an den Temperaturen liegt, eigentlich ist ab Anfang November Winterschlaf angesagt). Fledermäuse verursachen keinerlei Schäden (nur ein bisserl Dreck 😂) und mit ein paar gezielten Maßnahmen könnt ihr dafür sorgen, dass Fledermäuse bei euch ein Zuhause oder ein Winterquartier finden. Denn unsere heimischen Fledermäuse leiden tatsächlich unter Wohnungsnot und moderne Gebäude bieten immer weniger geeignete Quartiere. Es ist im Prinzip gar nicht schwierig, ein Haus oder eine Wohnung fledermausfreundlich zu gestalten. Die kleinen Flatterer würden es sich zum Beispiel gerne bei euch im Keller gemütlich machen. Dafür benötigt es ein paar Vorraussetzungen. Wichtig ist, daß sie absolut ungestört bleiben können und es dunkel ist. Sie brauchen natürlich eine katzensichere kleine Öffnung zum Durchschlüpfen, 4.8 cm Breite und 40-50cm Länge wären nötig, zB. durch die Holzverschalung von Fenstern. Ein geöffnetes/gekipptes Fenster geht auch, es darf nur keine Zugluft entstehen. Eine hohe Luftfeuchte wäre gut, damit die empfindlichen Flughäute nicht austrocknen. Ihr müsst bedenken, daß die Fledermäuse ca 6 Monate Winterschlaf halten. Ähnlich ist es bei ungenutzten Kaminen und Dachböden. Hier können wir den Zugang erleichtern, indem wir das Gitter von einigen Dachpfannen entfernen oder kleine Giebelfenster offen halten. Auch Scheunen und alte ungenutzte Garagen kommen in Frage. Sogar das Gartenhäuschen kann bezogen werden. Bei der Gestaltung von Fledermausquartieren kann man zB. Hangplätze an der Decke anbringen, das können Holzleisten oder Hohlblocksteine sein oder auch eine Verschalung mit Dachpfannen an der Kellerwand. Hauptsache es sind Zwischenwände mit Schlitzen und/oder Hohlräumen. Das können auch Zugänge hinter Wandverkleidungen sein. Man kann auch Fledermaussteine, Feldermausbretter oder Fledermausnistkästen anbringen. Sollte innen kein geeigneter Platz sein, geht es natürlich auch aussen. Fledermausbretter und Flachkästen können an jeder Hausfassade angebracht werden. Sie sind aus Holz oder Holzbeton und sind innen angeraut, damit sich die Fledermäuse gut festhalten können. Denn zum einen klettern sie hinein und zum anderen hängen sie bekanntlich auch gern an der Decke (ab). Die Nistkästen sind in mindestens zwei bis fünf Metern Höhe anzubringen. Norden als Einflugseite wäre nicht zu empfehlen, alle anderen Himmelsrichtungen sind kein Problem. Man kann die Fledermausbehausungen selbst bauen oder kaufen. Solltet ihr Freude daran haben, einen Nistkasten selbst zu bauen, gibt es viele Anleitungen im Internet zu finden. Es ist natürlich darauf zu achten, dass keine für Fledermäuse giftigen Holzschutzmittel verwendet werden. Es gibt aber Fledermausverträgliche Holzschutzmittel. Findet ihr eine hilflose Fledermaus, denn bitte nur mit Lederhandschuhen anfassen! Im Direktkontakt sind Bisse zu vermeiden, denn Fledermäuse könnten im Zweifelsfall immer noch Tollwut übertragen. Hinweise darauf sind Tiere, die tagsüber fliegen, orientierungslos wirken, flugunfähig sind und nahe gelegene Gegenstände angreifen. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt allen Menschen, die beruflich oder ehrenamtlich Umgang mit Fledermäusen haben, sich vorbeugend gegen Tollwut impfen zu lassen. Aber als Laie sollte man auf keinen Fall versuchen, eine Fledermaus selbst zu versorgen. Dafür - und für alle anderen Fragen, gibt es die Fledermaus Hotline vom NABU: Tel. 030-284 984 5000. Dort könntet ihr auch einen Experten zu Rate ziehen, wenn es darum geht, den Fledermäusen ein Zuhause bieten zu wollen. Übrigens, wer einen Garten hat, kann auch ein Fledermausbeet mit nachtblühenden, nektarreichen Blütenpflanzen anlegen, damit die Tiere auch Nahrung finden. Da sie hauptsächlich von Insekten leben, lockt auch ein Gartenteich. Aber die Pflanzzeit ist vorbei, daher folgen mehr Infos zum Fledermausbeet im Frühling.

Der Luchs ist die größte Wildkatze Europas. Früher gab es ihn fast überall in Europa. Auch Deutschland war einmal Luchsland. In nahezu allen unseren Wäldern waren die Tiere unterwegs. Mit zunehmender Besiedlung durch den Menschen sowie der fortschreitenden Rodung der Wälder war der Luchs im 19. Jahrhundert jedoch aus weiten Teilen West- und Mitteleuropas verschwunden. Nicht nur der Verlust seines Lebensraums und seiner Beutetiere machten der Population schwer zu schaffen, in seiner Not wurde der Luchs auch zum Viehräuber und daraufhin gnadenlos systematisch gejagt. 1850 wurde der letzte deutsche Luchs in den Alpen getötet und galt seitdem zusammen mit Wolf und Bär als ausgerottet. Heute kehrt er nun ganz langsam in unsere Wälder zurück. Neben dem in Deutschland verbreiteten Eurasischen Luchs (Lynx Lynx) gibt es weltweit noch drei weitere Vertreter der Gattung Luchs (Lynx): Der Pardelluchs (Lynx pardinus), der auch "Iberischer Luchs" genannt wird, war einst über ganz Spanien und Teilen von Portugal verbreitet. Dank intensiver Schutzmaßnahmen konnten sich die Restpopulationen wieder erholen. Heute leben wieder ca. 400 Tiere auf der Iberischen Halbinsel im Südwesten Spaniens, eine kleine Sensation! Der Kanadaluchs (Lynx canadensis) – auch "Polarluchs" genannt – kommt in Kanada und in Teilen der USA, insbesondere in Alaska vor. Er ist nicht direkt gefährdet, deutlich kleiner als der Eurasische Luchs und trägt von allen Luchsen das längste Fell. Wie unser heimischer Luchs besitzt auch er dicht behaarte Pfoten, die ein tiefes Einsinken im Schnee verhindern. Der Rotluchs (Lynx rufus), in Amerika aufgrund seines vergleichsweise kurzen Schwanzes „Bobcat“ genannt, ist eine Luchsart, deren Verbreitungsgebiet vom südlichen Kanada bis zum Norden Mexikos reicht. Rotluchse sind sehr anpassungsfähig und nutzen so unterschiedliche Lebensräume wie Wälder, Halbwüsten, die Randzonen von Städten und Sumpfgebiete. Die Art gilt als nicht bedroht. Darüber hinaus gibt es weltweit noch fünf Luchs-Unterarten. Luchse erreichen ungefähr die Größe eines Schäferhundes! Das Fell ist gefleckt, im Sommer ist es meistens rötlich braun und die Flecken sind stärker ausgeprägt, im Winter wird das Fell dichter und wechselt zu einer eher bräunlich-grauen Färbung. Das Muster eines jeden Luchses ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck – Forscher*innen können daran einzelne Luchse identifizieren und so mehr über ihre Wanderbewegungen und Familienbeziehungen herausfinden. Markant sind die schwarzen Pinsel an den Ohren sowie der ausgeprägte Backenbart. Der Schwanz ist von Natur aus sehr kurz. Sein Pfotenabdruck ist größer als der eines Fuchses und kleiner als der des Wolfs, aber dreimal so groß wie der einer Hauskatze. Die Wahrscheinlichkeit, einen Pfotenabdruck des scheuen Jägers zu entdecken, ist jedoch höher, als ihn selbst in freier Wildbahn zu beobachten: Luchse haben äußerst scharfe Sinne und meiden die Begegnung mit Menschen. Sie sind also in der Regel bereits lange vor einem Zusammentreffen über alle Berge. Das Sprichwort "Ohren wie ein Luchs" bewahrheitet sich also: die große Wildkatze ist äußerst hellhörig und sehr vorsichtig. Ihn so gut wie nie zu erblicken liegt unter anderem auch daran, daß er vor allem in der Dämmerung und nachts auf Pirsch geht. Zur seiner bevorzugten Beute zählen Kaninchen, Hasen und alle kleinen bis mittelgroßen Säuger und Vögel. Auch Fische und Insekten werden von ihnen gefressen. Luchse pirschen sich, wie wir es von unseren Katzen kennen, an ihre Beute heran und lauern ihr auf. Zwar können sie über kurze Strecken sprinten, ausdauernde Läufer wie beispielsweise Wölfe sind sie jedoch nicht. Und wenn sie ungestört bleiben, kehren Luchse mehrere Nächte zu ihrem Riss zurück, bis dieser fast komplett verwertet ist. Zwischen den Mahlzeiten versteckt der Luchs seine Beute unter einer Schicht Laub, Erde, Gras oder Schnee, damit andere Waldbewohner sie nicht finden. An einem Reh frisst ein ausgewachsener Luchs meist mehrere Tage, ein Hase oder Fuchs ist schon bei der ersten Mahlzeit vertilgt. Im Schnitt erlegt ein Luchs in einem Jahr knapp 50 Rehe. Aber nicht nur aufgrund des großen Beutespektrums sind Luchse absolute Waldliebhaber. Ein Naturwald verschafft ihnen die bevorzugte Blickdichte und genug Unterholz, um Deckung zu finden. Gibt es dann noch ein trockenes Plätzchen (z.B. eine Höhle), um Junge zur Welt zu bringen, sowie ein paar Felsen, auf denen es sich tagsüber in der Sonne faulenzen lässt, sind sie vollends zufrieden. Luchse sind aber flexibler als lange gedacht - sie können sich auch anpassen. So finden sie auch in an Wäldern angrenzenden Wiesen und Feldern ein Zuhause. Luchse haben riesige Reviere. Ihre Streifgebiete sind, um regelmäßig erfolgreich Beute zu machen, bis zu 400 Quadratkilometer groß. Teilen mögen sie das Gebiet aber nicht, außer mit den Damen :) Luchse sind absolute Einzelgänger und nicht sehr gesellig. Und es gibt gute Nachrichten: der Luchs ist wieder in Deutschland! Schon seit den 1970er Jahren gibt es dank mehrerer Wiederansiedlungsprojekten wieder einige dieser seltenen Tiere in Deutschland. Seine Hauptvorkommen hat der Meister der Tarnung heute im Harz und im Bayrischen Wald. Seit 2016 werden Luchse auch auch im Pfälzerwald erfolgreich wiederangesiedelt. Sichtungen von Einzeltieren gibt es immer wieder aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen sowie in der Lausitz. Auch in der Lüneburger Heide wurde das scheue Tier bereits gesichtet. Möglicherweise stammt es aus der Harz Population und hat einen wirklich sehr weiten Weg hinter sich - untypisch für einen Luchs, denn im Gegensatz Wölfen sind sie eigentlich nicht so wanderfreudig. Vermutlich geschieht es aus der Not heraus, zu wenig Beute zu finden. So trifft unser Luchs in der Lüneburger Heide aber auch auf zwei andere Neuankömmlinge: Den Wolf und die Wildkatze. Diese Situation ist in Deutschland bisher wohl einmalig. Der Wolf tauchte im Jahr 2011 zum ersten Mal in der Heide auf, die Wildkatze wurde 2017 zum ersten Mal dort nachgewiesen. Die drei Arten können sich und ihren Jungtieren zwar theoretisch gegenseitig gefährlich werden, es ist aber davon auszugehen, dass sich Wolf, Luchs und Wildkatze gegenseitig aus dem Weg gehen. Für die Lüneburger Heide ist dieses Aufeinandertreffen praktisch ein Qualitätssiegel: Wildtiere fühlen sich bei uns wohl! Trotz der Wiederbesiedlung steht das Projekt Luchs aber immer noch auf recht wackeligen Beinen, denn unsere Luchse in Deutschland werden unter Umständen allein an ihrem Standort bleiben. Unsere Landschaft ist zu zerschnitten für eine Begegnung zwischen unterschiedlichen Luchsen - ein genetischer Austausch ist also nicht wirklich möglich. Größte Gefahren für den Luchs sind heute das dichte Straßennetz mit hohem Verkehrsaufkommen, bei dem in den letzten Jahren etliche Tiere ums Leben kamen. Sie sind bedroht von Krankheiten und was am meisten schmerzt: illegale Wilderei von Jägern und Hobbyjägern. Obwohl Luchse streng geschützt sind, gibt es immer wieder gezielte Tötungen. In Deutschland sind zwischen 2000 und 2018 sieben Luchse nachweislich getötet worden. Die Dunkelziffer muss jedoch um ein Vielfaches höher eingeschätzt werden. Auch heute noch gilt der Luchs hierzulande laut "Roter Liste" als stark gefährdet. Er ist deshalb auch in der europäischen Fauna-Flora-Habitatrichtlinie gelistet. Somit hat Deutschland die Verpflichtung, den Luchs streng zu schützen und Schutzgebiete auszuweisen. Darüber hinaus benennt die "Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt" der Bundesregierung das Ziel, den Luchs bis 2020 in den Mittelgebirgen und bayerischen Alpen wieder heimisch zu machen – davon sind wir momentan leider noch weit entfernt. Eine stabile Population wäre bei 1000 Tieren erreicht. In Deutschland zählen wir gerade mal 85 der scheuen Jäger - zu wenige Tiere, um ihr Überleben dauerhaft zu sichern. Wir brauchen also eine Wiedervernetzung von Lebensräumen, damit die Luchse unbeschadet durchs Land ziehen können - auch entschärfte Verkehrswege helfen dabei ungemein! Verschiedene Tier-und Naturschutzvereine wie BUND und NABU arbeiten weiterhin an der Vision, dass Luchse in Mitteleuropa wieder flächendeckend in geeignete Lebensräume zurückkehren können. Der BUND fordert zusammen mit dem WWF im "Aktionsplan Luchs", die Lebensräume des Luchses besser zu vernetzen, illegale Tötungen strikt zu verfolgen, die Bevölkerung einzubeziehen und Schutzmaßnahmen länderübergreifend zu konzipieren. Dabei werden unter anderem auch große Waldflächen aufgekauft, die von Spenden finanziert werden. Eine wirklich tolle und nachhaltige Maßnahme! Der Luchs ist ein wichtiger Bestandteil unserer biologischen Vielfalt. Mit seiner Rückkehr vervollständigt sich unsere Natur wieder ein Stück.

Bäume bergen viele Geheimnisse. Sie sind und bleiben majestätische, aber auch rätselhafte und stille Wesen. Schon lange gibt es den Glauben, daß Bäume ein eigenes geheimes Leben führen - und sich auch bewegen können. J.R.R. Tolkien nutzte dies schon 1937 / 1954 für seine Fantasyromane Mittelerdes, wo Bäume und Wälder lebendig wurden. Er erschuf die „Ents“, Baumwesen, die für den Schutz der Wälder sorgten und den Wald von Fangorn, wo sich Bäume gegen die Welt zur Wehr setzten. Der heutige Bestseller „Das geheime Leben der Bäume“ von Peter Wohlleben zeigt uns noch mehr faszinierende Einblicke: Bäume sind lebendig, das weiß man, aber sie sind eventuell lebendiger als man das bislang gedacht hat. Sie können mit einander kommunizieren und leben in Familienverbänden. Was jetzt aber kommt, übertrifft bei weitem alles, was wir je gehört haben - Bäume haben einen Herzschlag! Bisher war es der allgemeine Wissensstand der Forschung, daß der Wasserfluss durch die Bäume rein auf einem Osmoseprozess beruht, denn alle Pflanzen benötigen Wasser, welches sie zur Photosynthese und Produktion von Glucose (Zucker)zum Wachstum benötigen. Es ist jedoch nicht einfach, die Bewegung des Wassers durch die Tracheiden (ähnlich wie Adern) in Bäumen zu verfolgen. Nun wurde die Sensation entdeckt: Stämme und Äste von Bäumen ziehen sich zusammen und dehnen sich wieder aus. So „pumpen“ sie das Wasser von den Wurzeln aus dem Boden bis in die höchste Spitze - ähnlich, wie unser Herzschlag Blut durch die Adern unseres Körpers pumpt. Der „Pulsschlag” ist jedoch sehr viel langsamer als beim Menschen. Und zwar so langsam, daß er bisher nicht erkannt wurde. Während der menschliche Pulsschlag bei 50 bis 80 Schlägen pro Minute liegt, pumpt das „Baumherz“ ca. alle zwei Stunden einmal das Wasser durch die Äste und Zweige. Das konnte nun der Forscher Dr. András Zlinszky von der Universität Aarhus in Dänemark beweisen. Die Studien dazu wurden schon seit 2016/17 ausgeführt und von Zlinsky und seinem Kollegen Anders Barfod geleitet.Ihre Messungen fanden in Gewächshäusern statt, um zB. Einflüsse von Wind ausschließen zu können. Mit Hilfe von Laserstrahlen wurden die exakten Positionen der Äste und Blätter von 22 verschiedenen Baum- und Buscharten gemessen. Hier gab es Beobachtungen von unerwarteten regelmäßigen Bewegungszyklen: In der Nacht senkten sich die Äste, um sich dann zum Morgen wieder aufzurichten, so, als würde der Baum nach einem Schlaf wieder erwachen. Dies deutet auf einen Kreislauf von Wasser-und Zuckertransport hin. Es wurden Höhenunterschiede der Äste von bis zu 10cm festgestellt. Am ausgeprägtesten war, dass eine Magnolie (Magnolia gradiflora) drei vollständige Anpassungszyklen ihrer Zweige durchlief. Die Forscher hoffen, mit diesen Ergebnissen Stress und Krankheiten bei Bäumen zu diagnostizieren zu können, um sie mit Hilfe einer zeitnahen Behandlung zu heilen. Die Ergebnisse der Studie sind im Fachmagazin »Plant Signaling & Behavior« veröffentlicht. Quelle: www.iflscience.com und www.newscientist.com. Diese Arbeit ist nur ein Beispiel für eine wachsende Zahl an Literatur, die zeigt, wieviel mehr verborgene und geheime Dinge es auf dieser Welt gibt, mehr, als unsere Augen sehen.

Die Zugvögel sind seit Wochen fort und meine kleine Vogelwelt im Wald hat sich so ziemlich dezimiert. Umso mehr habe ich mich gefreut, den kleinen Baumläufer wiederzusehen, der hurtig den Baumstamm heraufflitzt - aber nur, wenn alle anderen verschwunden sind, um an dem in Talg eingelegten Nusszapfen zu picken. Der Baumläufer (Certhiidae, aus der Familie der Sperlingsvögel) ist also ein Standvogel, der über den Winter da bleibt und, wie alle anderen Vögel, nun vermehrt Fettfutter benötigt. Er ist wirklich winzig, ungefähr 10-12cm und gehört damit zu den kleinsten Vögeln Europas. Sein Gewicht sind etwa 9-11g. Die Größe ist mit einem Zaunkönig vergleichbar, wobei man den Unterschied gut an Schnabel, Schwänzlein, Verhalten und Federkleid erkennen kann. Der Baumläufer hat zwar einen hellen, cremefarbigen Bauch, jedoch einen braun getupften Rücken. Auf der Baumrinde ist es eine wirklich gute Tarnung, so daß er nur aufgrund seiner Bewegung, einem sprunghaften und ruckartigem Laufen und Klettern, zu erkennen ist. Beim Klettern stützt er sich mit den langen Schwanzfedern ab. Er ist dabei besonders häufig an Laubbäumen wie Eichen, Eschen und Ulmen zu beobachten, die eine tief zerfurchte Rinde aufweisen. Meist sucht er die Spalten in der Baumrinde nach Insekten, Gliederfüsslern und Spinnen ab. Was er nicht frisst, versteckt er mit seinem langen gebogenen Schnäbelchen, dem Pinzettschnabel, in der Baumrinde für später. Mein Specht, Eric, macht das übrigens genauso, was dann bedeutet, daß sie durchaus die Vorräte des anderen finden. Aber solang immer wieder etwas nachgeliefert wird glaube ich, daß beide davon profitieren. Bei anderen Vögeln habe ich dieses Verhalten noch nicht beobachten können und fand das Schauspiel am Baum wirklich hochamüsant - der eine versteckt etwas, 2 min später kam der andere und holte es wieder heraus😂 Baumläufer können übrigens auch am Stamm kopfüber herunter laufen. Und sie schlafen in flachen Rindenmulden oder Baumspalten, die sie manchmal auch mit dem Schnabel vergrößern. Dort übernachten sie dann auch zu mehreren gemeinsam, wenn es im Winter kalt wird. Ist das nicht niedlich? Es gibt zehn Arten von Baumläufern, wobei hier im Wald dann der Waldbaumläufer (Certhia familiaris) lebt. Er bewohnt ganzjährig Nadel-und Mischwälder in Europa, anteilig in Asien, Sibirien und Japan. Der europäische Bestand wird auf 5,7 bis 11 Mio. Brutpaare geschätzt (25–50 % des Weltbestandes). Sein Ruf klingt in etwa wie "siih" oder "tih". Die kurze Gesangsstrophe ist eine abfallende, zum Ende wieder ansteigende Reihe von leisen Pfeiftönen und erinnert an die Lautäußerungen von Blaumeise und Fitis. Da muss ich nochmal genauer hinhören. Waldbaumläufer können bis zu sieben Jahre alt werden. Ein wirklich stolzes Alter für so ein kleines Geschöpf! In Laubwäldern, Parks und Gärten mit vielen Obstbäumen, in Alleen, Feldgehölzen und Streuobstwiesen treffen wir dann den nahen Verwandten des Waldbaumläufers, den Gartenbaumläufer. Optisch sind sie nicht auseinander zu halten und in der Regel muss man die Lautäußerungen heranziehen, um beide Arten zu trennen. Der Ruf des Gartenbaumläufers klingt in etwa wie „tihtih“. Der Gesang ist kürzer und insgesamt kräftiger und lauter als der des Waldbaumläufers. Die melodische kurze Pfeifstrophe ähnelt einem "titi-tiro-iti-titt" oder "di-dideli-di-di". Der Gartenbaumläufer besiedelt West-und Mitteleuropa und brütet auch im Süden, sogar in Westen Asiens und Nordafrika. In Großbritannien, Irland und im Norden Dänemarks ist er allerdings nicht anzutreffen. Die Bestandssituation des Gartenbaumläufers wurde 2016 in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN als „Least Concern (LC)“ = „nicht gefährdet“ eingestuft. An künstlich geschaffenen Winterfutterplätzen trifft man den Gartenbaumläufer eher selten als Gast an. Sollte er sich dennoch an einem Futterhaus einfinden, bevorzugt er fetthaltiges, weiches Winterfutter. Und vielleicht habt ihr ja auch schon einen in eurem Garten gesehen…

Es gibt Vögel, in deren Namen das Wort „Ohr“ vorkommt, zum Beispiel die Ohrenlerche oder den Ohrentaucher. Bei den Eulen scheinen die Lauscher ebenfalls eine wichtige Rolle zu spielen: Da wäre die Zwergohreule, die Waldohreule (s.Bild) oder die Sumpfohreule. Bei ihren „Ohren“, den aufgestellten Puscheln, handelt es sich allerdings nur um größere abstehende Kopffedern. Eine nach außen gewölbte Ohrmuschel wie beim Menschen und anderen Säugetieren gibt es nicht - sie würde den Vogel nur in seinem Flug und der damit verbundenen Aerodynamik stören. Bei Vögeln befindet sich das Gehör am Kopf, unsichtbar unter dem Federkleid. Dort sind sie gut versteckt und auch geschützt vor schlimmen Krankheiten. Oft sitzen die Ohren der Vögel schräg, etwas unterhalb der Augen. Das Innenohr ist prinzipiell dem der Säugetiere im Aufbau ähnlich, allerdings ist sein Gehörorgan, auch Basilarpapille genannt, wesentlich kürzer als bei uns. Das hat zur Folge, dass Vögel höhere Frequenzen nicht so gut hören können - meistens nur bis zu einer Frequenz von etwa 6.000 Hz. Damit bleiben sie weit hinter den Leistungen vieler Säugetiere (auch des Menschen) zurück. Eine Ausnahme bilden die Eulen, die als Nachtjäger bis zu einer Frequenz von circa 10.000 Hertz hören können. Das benötigen sie auch, um ihre Beute zu orten. Vögel können aber Schallwellen wahrnehmen. Gerade Singvögel sind darauf angewiesen, gut hören zu können. Mit ihrem Gesang finden sie ihren Partner und grenzen ihr Revier ab - wie unser laut trällerndes morgendliches Rotkehlchen. Vögel kommunizieren über ihre Stimme in unterschiedlichsten Rufen und Gesängen, ob zirpend oder melodisch, denn die Schallsignale ihrer Rufe lassen sich in Frequenz, Lautstärke und Abfolge unterschiedlicher Laute vielfältig variieren. Ihre Melodien können sehr einfach sein, wie bei einem Zilpzalp (dessen eintöniger Gesang ihm seinen Namen gab), oder sehr variationsreich mit vielen Abstufungen wie bei einer Nachtigall. Lange haben sich Wissenschaftler gefragt, ob Vögel erkennen können, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt, sie differenzieren können, ob die Schallquelle sich seitlich, ober- oder unterhalb von ihnen befindet. Wir Menschen können das ja dank unserer nach außen gewölbten Ohrmuscheln. Ein Forschungsteam der Technischen Universität München (TUM) hat vor gar nicht langer Zeit herausgefunden, wie Vögel Geräusche orten: Die Aufgabe der Außenohren übernimmt bei ihnen der ganze Kopf. Denn offenbar verändert ihr leicht oval geformter Kopf Schallwellen in ähnlicher Weise wie Ohrmuscheln. Seine spezifische Form sorgt dafür, dass Schallwellen zurückgeworfen, geschluckt oder abgelenkt werden. So können zum Beispiel Schallwellen über den Kopf wandern und eine Reaktion am gegenüberliegenden Ohr auslösen. Ob ein Geräusch von oben oder unten kommt, errechnet dann das Gehirn aus den unterschiedlichen Lautstärken an beiden Ohren. So haben Vögel das vertikale Hören entwickelt. Ihre Augen sitzen außerdem seitlich - und damit haben sie ein Sehfeld von nahezu 360 Grad! Hör- und Sehsinn ergänzen sich in idealer Weise - eine wichtige Fähigkeit für Vögel, um nicht als Beutetier zu enden. Ich finde: das ist ein kleines Meisterwerk der Evolution.

Unser Feldhase ist berühmt. Er hat seinen Platz in Märchen, Fabeln, Sprichwörtern und unserer Kultur zu Ostern. Außerordentlich bekannt ist das Bild eines jungen Feldhasen von Albrecht Dürer. Wenn jemand "die Löffel spitzt", dann ist er "ganz Ohr", und "sperrt seine Lauscher auf" - er hört also ganz genau hin. Der Begriff „Angsthase“ (vom alten Wort „Hasze“, verfolgen) bedeutet übrigens „der von Angst Verfolgte“, wobei dem schlauen Hasen Angst unterstellt wird, denn Verstecken und Flucht ist Teil seiner Taktik und Überlebensinstinkt. Der Feldhase (Lepus europaeus) ist ein Säugetier aus der Familie der Hasen (Leporidae). Er gehört nicht zu den Nagetieren wie Kaninchen, sondern zu den Hasenartigen der Familie der Hasen (Leporidae). Sein nächster Verwandter ist der Schneehase. Der Mümmelmann kann bis zu 57cm lang und zwischen 2,5 - 8kg schwer werden und ist damit dem Wildkaninchen an Größe weitaus überlegen. Außerdem kann er ein stolzes Alter von bis zu 12 Jahren erreichen, wenn er Glück hat. Das Fell des Hasen, die äußeren Grannenhaare, sind besonders feuchtigkeitsabweisend und wärmend. Bauch und Schwanzunterseite sind weiß. Der Schwanz des Hasen ist etwa zehn Zentimeter lang und wird „Blume“ genannt. Seinen Spitznamen hat Meister Lampe durch sein weißes hochstehendes Puschelschwänzchen bekommen. Im Sommer ist das Fell des Feldhasen erdbraun, im Winter gräulich-braun. Damit ist der Feldhase auch optisch perfekt an seine Umgebung angepasst. Der Hasenbart ist weiß – seine dicken und festen Haare dienen dem Feldhasen als Tasthaare. Die Hinterläufe des Feldhasen sind extrem lang. Deshalb „hoppelt“ er. Das mag ungelenk aussehen, doch er ist ein Spitzensportler auf dem Acker. Feldhasen können bis zu drei Meter weit und zwei Meter hoch springen! Berühmt sind ihre abrupten Richtungswechsel – das Haken schlagen. Auf der Flucht erreichen Feldhasen Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometer pro Stunde – sie sind also schneller, als jeder internationale Spitzensportler bei Olympia! So kann er seinen natürlichen Feinden, wie Fuchs, Wolf, Wildschwein, Raben- und Greifvögeln, aber auch Marder und streunenden Katzen geschickt entkommen. Aber zunächst ist der Feldhase ein Meister der Tarnung. Bei Gefahr hockt er sich mit seinen langen angelegten Ohren (Löffel genannt) tief und regungslos in seine Sasse, eine kleine Mulde auf dem Acker, die er auch tagsüber als Versteck nutzt. Dort macht er zuvor einen großen Sprung hinein, um seinen Feinden keine Duftspur zu hinterlassen. Das Tier nimmt jede noch so geringe Bodenerschütterung wahr. Der Feldhase ist zwar kurzsichtig, aber sieht insbesondere Bewegungen (Bewegungsseher). Durch seine seitlichen Augen hat er den perfekten Überblick in einen Bereich von nahezu 360 Grad. Entsprechend wählt er seine Sasse so aus, daß er sein Umfeld weiträumig überblicken kann. So lange wie möglich bleibt der Feldhase in seinem ausgezeichneten Versteck liegen und ergreift nur die Flucht in allerletzter Sekunde. Viele Menschen gehen davon aus, dass der Feldhase keine Laute von sich gibt. Doch stumm ist er nicht! Im Gegenteil: Wer richtig hinhört, kann aus nächster Nähe ab und an ein leises „Murren“ wahrnehmen. Junghasen quietschen auch gelegentlich. In Situationen höchster Gefahr hört man von ihm einen durchdringenden, quäkenden Laut. Der Jäger spricht dann vom sogenannten „Klagen“, da sich die Laute wie das Geschrei eines Kindes anhören. Der Feldhase ist grundsätzlich sehr scheu. Man bekommt ihn nur selten zu Gesicht, da er die meiste Zeit des Jahres nachtaktiv und als Einzelgänger lebt. Es gibt im Gegensatz zu Kaninchen keine Kolonien. Zur Paarungszeit treffen die Hasen dann aufeinander. Die Männchen kämpfen um die Weibchen. Dabei stellen sie sich auf die Hinterbeine und boxen sich. Eine Häsin kann drei bis viermal im Jahr Nachwuchs bekommen. Meister Lampe ist jedoch standorttreu und behält sein Revier ein Leben lang. Außerdem liebt er warmes und trockendes Wetter. Er stammt ursprünglich aus der Steppenlandschaft. In unserer heutigen Kulturlandschaft bevorzugt er strukturreiche Agrarlandschaften mit Feldgehölzen, Ackerrandstreifen und Brachflächen, die ihm Nahrung und Versteckmöglichkeiten bieten. Da vielfach vom Menschen eingeschleppt, besiedelt er fast alle Kontinente. Umweltschützer und Biologen beobachten, dass Hasenpopulationen immer mehr an den Rand oder in große Grünflächen von Städten umsiedeln. Als Ursache vermuten die Experten, dass die natürlichen Feinde der Hasen hier kaum anzutreffen sind. Es gibt ca. 3.000.000 Feldhasen in Deutschland. Betrachtet man die Bevölkerungszahl Deutschlands, kommen 27 Menschen auf einen Hasen. Trotzdem gibt es in vielen einzelnen Regionen immer weniger Feldhasen. Forscher beunruhigt das. Sie wissen: Wenn schon für den anpassungsfähigen Feldhasen die Lebensbedingungen immer schlechter werden, sind manch andere Arten in der Agrarlandschaft längst ausgestorben. Durch die Intensivierung in der Landwirtschaft verliert der Feldhase an Lebensraum und Nahrungsangebot. Denn Feldhasen sind Pflanzenfresser. Zu ihrer Nahrung zählen Gräser, Kräuter, Wurzeln und Knollen. Manchmal fressen sie auch Getreide und Kohl. Im Herbst steigt der Anteil an Samen, im Winter mümmeln sie auch Rinde, Knospen und Zweige. Dünger und Pestizide der Felder wirken sich negativ auf den Hasenbestand aus. Äcker werden vollständig abgeerntet und Felder so angelegt, dass sie dem Feldhasen keine Versteckmöglichkeiten mehr bieten. In der aufgeräumten Agrarlandschaft haben seine natürlichen Feinde dann ein leichtes Spiel. Neue Gewerbe- und Siedlungsgebiete, sowie das zunehmende Zerschneiden von Landschaften durch z.B. Straßenbau machen ihm das Leben schwer. In Deutschland fallen jährlich ungefähr 60.000 Feldhasen dem Straßenverkehr zum Opfer. Seit den 1960er Jahren ist der Bestand in vielen Teilen Europas stark abnehmend. Feldhasen werden in fast allen Ländern Europas bejagt. In Deutschland wurden im Jagdjahr 1985/86 rund 825.000 Feldhasen geschossen, danach war die Zahl stark rückläufig und erreichte 1997/98 mit 406.000 erlegten Tieren ihren damals niedrigsten Stand. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg der Population wurden in Deutschland im Jahr 2003/04 rund 568.000 Feldhasen geschossen.Seitdem gingen die Jagdstrecken wieder zurück. Im Jagdjahr 2015/16 wurden 242.000 Hasen erlegt. Die Schonzeit für Hasen beginnt 01.01. - 30.09. Trotz des dramatischen Bestandsrückgangs gibt es weiterhin Schusszeiten vom 01.10. - 31.12., gegen die unter anderem der NABU Einspruch erhebt. Echte Feldhasen lassen sich übrigens nur sehr schwer bis gar nicht in Gefangenschaft halten, was eine Wiederanssiedlung letztlich fast aussichtslos machen würde. In Deutschland gehören Feldhasen zu der bedrohten Tierart (Stufe 3 von 4). Die Art wird in der Roten Liste als „gefährdet“ geführt, in einigen Bundesländern wie Brandenburg und Sachsen-Anhalt als „stark gefährdet“. Der Weltbestand gilt laut IUCN als ungefährdet („least concern“). Die Schutzgemeinschaft "Deutsches Wild" erklärte den Feldhasen für das Jahr 2001 und erneut 2015 zum Tier des Jahres. Im Wesentlichen bestimmt die Förderpolitik der EU über die milliardenschweren Subventionen für Agarwirtschaft und somit auch über die Landnutzung in Deutschland und Europa. Es gibt jedoch Dinge, die wir für den Hasen tun können. Durch die Anlage von Blühstreifen, Hecken und eine Extensivierung der Landbewirtschaftung könnten Nahrungsangebot und Rückzugsmöglichkeiten deutlich verbessert werden. Der Feldhase braucht auch die Brachlandflächen als Ruheoasen. Daher ist es entscheidend, dass die Agrarlandschaft als Lebensraum verbessert wird. Für dieses Ziel setzt sich die „Deutsche Wildtier Stiftung“ mit Projekten wie „Hasenland“ in der Politik, der Forschung und im direkten Kontakt mit Landwirten ein. In „Hasenland“ werden künftig keine Feldhasen mehr erlegt und eine frühe Mahd vermieden. Diese findet zum Schutz der Jungtiere erst ab dem 1. Juli statt. Es gibt außerdem keine Mahd zu Nacht. Neben dem Hasen profitieren von solchen Maßnahmen viele andere heimische Tierarten, darunter bedrohte Wiesenvögel wie Kiebitz und Feldlerche, aber auch Bienen und andere Insekten. Speziell kann jeder von uns den Tieren, die in Wald, Flur und auf dem Felde leben, helfen. Und das geht einfacher als gedacht. Wir können möglichst viele bienenfreundliche Blumenwiesen anlegen - und auf unsere Ernährung achten: möglichst Mais vermeiden, auch über Futtermais nachdenken und lieber Getreide aus dem Ökoanbau kaufen. Es mag etwas teurer sein, aber ich sehe das als „Spende“ für unsere zukünftige Tier-und Pflanzenwelt. Das war jetzt ein langer Text - vielen Dank für eure Aufmerksamkeit

Stahlgrauer Rücken, schwarzer Kopf, die schwarzen Flügel weisen eine weiße Binde auf, intensive rote Brust - unverkennbar an diesen Farben und der etwas kräftigen Statur ist der Gimpel, der auch Dompfaff genannt wird (Pyrrhula pyrrhula). Es gibt auch noch die seltene Bezeichnung „Blutfink“, die im Sprachgebrauch zumindest hier im Norden nicht häufig verwendet wird. Im Jahr 1758 bezeichnete der schwedische Naturforscher und Urvater der Grundlagen von moderner botanischer und zoologischer Taxonomie, Carl von Linné, den Gimpel als Loxia pyrrhula. Der Name Gimpel leitet sich vom bayrisch-österreichischen Wort gumpen = hüpfen ab. Er wird metaphorisch oft auf einen Leichtgläubigen angewandt, da sich der Vogel früher durch Nachahmung seines Rufs leicht fangen ließ.Die Bezeichnung Dompfaff resultiert daraus, dass die kompakte Gestalt mit dem roten Gewand und der schwarzen Kappe von manchen Leuten mit einem Domherren assoziiert wurde. Die weiteren Namen wie Blutfink, Rotgimpel, Rotfink, Rotvogel, Pollenbeißer (Knospenbeißer), Gücker und Goll werden nur in bestimmten Landstrichen verwendet. In Ostwestfalen wird der Blutfink "Bleotfinken", im Bergischen Land "Blautfink" oder "Blotfink" und bei Erkelenz "Blootvenk" genannt. In Rheinberg lautet eine Redensart: „Dän ös schtols wi ene Gempel.“ (Hochdeutsch: „Der ist stolz wie ein Gimpel.“) In Großbritannien wird der Gimpel als Bullfinch (Bullenfink) bezeichnet, in den Niederlanden als Goudvink (Goldfink). Gimpel gehören zu der Familie der Sperlingsvögel (Passeriformes). Sie haben eine Körperlänge von etwa 15 bis 19 Zentimetern, das Körpergewicht liegt meist bei etwa 26 Gramm. Männchen und Weibchen unterscheiden sich durch die Farben - die Damen sind deutlich tarnfarbender und haben eine beige-graue Brust, jedoch auch ein dunkles Köpfchen und auf dem Rücken sind sie ebenso dunkel, aber eher bräunlichgrau. Der Gimpel besiedelt Europa, Vorderasien, Ostasien einschließlich Kamtschatka und Japan sowie Sibirien. Er lebt im Nadelwald, überwiegend in Fichten-Schonungen, aber auch in lichten Mischwäldern mit wenig Nadelbäumen oder Unterholz. Er ist auch an den Rändern von Lichtungen, an Kahlschlägen sowie an Wegen und Schneisen zu finden. Der Gimpel sucht auch häufig Parkanlagen und Gärten auf. Hier müssen jedoch unbedingt Nadelbäume, insbesondere Fichten, vorhanden sein. Selten ist er auf Friedhöfen oder Biotopen, die mit Birken und dichtem Gebüsch bewachsen sind, zu finden. Im Frühjahr sucht er oft Obstplantagen oder Streuobstwiesen auf. Der Gimpel ist ein Stand- und Strichvogel. Allerdings ist er zur Winterzeit öfter zu sehen. Viele nördliche Populationen ziehen südwärts. Auch während der Brutzeit verhält sich der Gimpel eher unauffällig. Das gilt besonders für seinen leisen, vor sich hin plaudernden Gesang. Am häufigsten hört man noch sein weich geflötetes, in der Tonlage abfallendes langezogendes „diüü“. Das ist der Lockruf. Der Stimmfühlungsruf des Gimpels äußert sich in einem leisen „bit-bit“. Von September bis Ende Februar singen die Weibchen ebenso laut und anhaltend wie die Männchen, stellen jedoch mit Beginn der Paarungszeit den Gesang ein. Gimpel führen eine monogame Brutehe. Für einen lebenslangen Zusammenhalt fehlen leider noch die Beweise. Der Gimpel ist wenig territorial. So verteidigt er zwar den Nestbereich, jedoch kein Revier, im Gegensatz zu dem Rotkehlchen. Auf dem Speiseplan des Gimpels steht ganz überwiegend vegetarische Kost. Im Frühjahr haben es ihm vor allem die frischen Knospen von Laubbäumen angetan, im Sommer kommen Beeren hinzu, besonders aber kleinere Samen von Stauden und Kräutern. Der Gartenbesitzer kann auch aktiv etwas für diesen hübschen Vogel tun – zunächst durch Nichtstun. Denn wenn wir zum Beispiel Blumen nach der Blüte nicht sofort abschneiden und Stauden über den Winter nicht komplett zurückschneiden, ist dem Gimpel schonmal ein Festmahl sicher. Ab dem 19. Jahrhundert bis heute wird der Gimpel gern als Käfigvogel gehalten, jedoch nur in der Zucht. In Deutschland sind Entnahmen aus der Natur seit 1988 entsagt. In Umsetzung der EU-Vogelschutzrichtlinie von 1979, die dies für das gesamte europäische Gebiet der EU zum Ziel hatte, gelten für alle Exemplare wildlebender und heimischer Vogelarten weitreichende Zugriffs-,Vermarktungs- und Besitzverbote. Auch in der Mythologie hat der Gimpel seinen Platz gefunden: Früher stellte er ein Symbol für Tölpelhaftigkeit, Ungeschicklichkeit und Dummheit dar. Er ist aber auch häufig als schmückendes Hintergrundmotiv auf alten Darstellungen des Garten Eden zu finden. So sind Gimpel beispielsweise in dem Gemälde „Paradiesdarstellung mit Sündenfall“ (1615) von Jan Brueghel dem Älteren und Peter Paul Rubens dargestellt. Ersterer bildete die Art auch im Gemälde „Paradiesische Landschaft mit der Arche Noah“ (1596) ab, auf der die Versammlung der Tiere vor der Arche Noah dargestellt ist.

Vor kurzem hörte ich einen Ruf im Dunkeln. Ein wenig klang er wie ein Raubvogel. Ich hörte mir sämtliche Datenbanken mit Vogelrufen an...nichts zu finden. Meine letzte Hoffnung war der Greifvogelbeauftragte vom NABU. Ich schrieb ihm eine E-Mail und bekam prompt eine Antwort - die mich sehr überraschte: Der Ruf im Dunkeln war also ein Waldkauz (strip aluco). Normalerweise kennt man seinen Ruf als „Krimi-Eule“, ihr wisst schon, bei gruseligen Szenen auf dem Friedhof und ähnlichem. Das klingt ungefähr so: „Huh-Huhuhu-Huuuh!“ (Einmal nachmachen bitte 😂) Er ist hauptsächlich nachtaktiv. Von September bis November sowie im Frühjahr ist der Reviergesang des Männchens weithin hörbar. Die Balz des Waldkauzes fängt im Herbst an. Meine Tonaufnahme vor ein paar Tagen war der Ruf eines Weibchens zur Herbstbalz (wird auch Vorbalz genannt, die eigentliche Balz findet ja erst im Frühjahr statt).Waldkäuze verfügen über ein großes Lautrepertoire, deren einzelne Rufe in Lautstärke und Klangfarbe stark variieren. So kann es auch vorkommen, daß der Waldkauz in Frankreich ganz anders ruft als der in Deutschland. Typisch für den kleinen Waldkauz sind seine süßen schwarzen Knopfaugen. Er hat, wie einige Eulen, eine recht pummelige Erscheinung mit einem dickem Kopf, aber ohne Puschelöhrchen, dazu kurze Flügel und Schwanzfedern. Das Gefieder kann in Grau, Braun-und Rottönen variieren. Waldkäuze mit einer braunen Grundfärbung treten vor allem in Waldgebieten auf. In kälteren Gebieten, wie zB Finnland passt sich die Farbgebung an und tritt häufiger in einem Grauton in Erscheinung. Der Waldkauz besiedelt als mitunter häufigste Eulenart ganz Europa bis hin nach Westsibirien. Er bevorzugt Mischwälder und eine eher strukturreiche Landschaft. Wichtig ist jedoch ein alter Baumbestand mit Höhlen, denn der Waldkauz ist ein Höhlenbrüter. Nisten tut er in Mauerlöchern, Felshöhlen und - weil er sehr anpassungsfähig ist - besetzt er auch gern mal einen Kaninchenbau. Sein Nest in der Nähe zu Menschen ist möglich, sofern er weitestgehend ungestört ist. Daher findet man ihn auch oft in alten Scheunen und auf verstaubten Dachböden. Waldkäuze sind ausgeprägte Standvögel, die ihr Revier auch im Winter nicht verlassen. Sie sind wendige Flieger, die auch in dichten Baumbeständen sicher und schnell manövrieren. Ihr Flug ist komplett geräuschlos! Noch erstaunlicher finde ich, das wenn sich ein Waldkauzpaar gefunden hat, es ein Leben lang zusammen bleibt. Und das auch im gleichen Revier. Ich darf also hoffen, daß ich meine kleine Waldkauzdame nicht zum letzten Mal gehört habe 🥰 Euer Waldmädchen

Die ganze Nacht war ich auf Mäusejagd.!! Ihr könnt euch vorstellen, wie fertig ich gerad bin. Wie das kam? Ich hab seit Wochen eine Maus im Haus. Erst war ich ja ganz verzückt, sie hatte sich meine Kommodenschublade als neues Zuhause ausgesucht. Aber dann machte sie jede Nacht Krach und ich hab seit 2 Wochen nicht richtig geschlafen 😂 Meine Waldmaus aka Hausmaus hat mich so richtig auf Trab gehalten. Je länger sie nun bei mir wohnte, desto näher lernten wir uns kennen. In die Schublade, in der sie ihr erstes Nest aus meiner Tischdecke gerupft hat, ist sie nicht wieder zurückgekehrt. Statt dessen hat sie ein erneutes Nest gebaut- unter meiner Spüle in der Küche. Sie hat sämtliche Stofftaschen gerupft und beköddelt, genau wie meine Tischdecke. Ich hab dann alles weg geschmissen und gesäubert. Zwischendurch hatte ich sie dann gesehen. Sie ist wirklich irre schnell, ein kleiner grauer Blitz. Auffällig ist es, wenn sie dann auf einmal mir nichts Dir nichts verschwindet. Als erstes dachte ich, sie ist an mir vorbei geflitzt aber nein! Siehe da. Unter meiner Kochzeile und den Einbauschränken befand sich ein riesiger Schlitz. Dieser führt zu einem Leerraum, an den Gas-und Wasserrohren vorbei bis hin nach draussen. Ich ging also raus, kniete mich hin und griff unter die Holzfassade. Okay, da war eine Metallleiste, parallel zur Hausinnenwand...ich tastete weiter, Spinnenweben! 😱 schnell abgeschüttelt! Aber dann bemerkte ich auch da einen ziemlich langen Schlitz. So kam sie also von Draussen rein! Ja perfekt für die kleine Maus, von dort aus ins Hausinnere zu gelangen und sämtliche Gänge in den Wänden zu nutzen. Sogar bis zu ihrem dritten Lager, das war dann mein Waschbeckenunterschrank im Bad. Sie kam über die Rohre und Löcher in den Schrank und zerrupfte fleissig mein Klopapier. Nachdem ich dann auch das 3. Nest hochgenommen hatte, war mir klar, daß ich jetzt gezielter suchen musste, da ich jetzt wußte, wie und wo sie sich fortbewegt. Man könnte sagen, ich bin gerad zu einem echten Mausexperten geworden 😂 Die Lebendfallen hat sie übrigens alle durchschaut. So lecker das auch war. Sogar desinfiziert hab ich sie, damit mein Geruch nicht skeptisch macht. Mäuse laufen ja gern an der Wand entlang, das ist für sie sicherer. Dort hatte ich auch zwei Fallen platziert, an denen sie gekonnt dran vorbei gelaufen ist. Ich musste also erstmal alle Schlupflöcher beseitigen. Als erstes habe ich mir die Aussenfassade vorgenommen. Mit Eisenwolle habe ich die Schlitze komplett zugestopft. Eisenwolle kann man übrigens auch für drinnen nehmen. Mäuse mögen daran nicht knabbern und so bleibt es dicht. Jeden Spalt, jeden Riss oder Loch in der Wand habe ich damit gestopft und anschließend gespachtelt, ihr letzte Nacht eine Fluchtmöglichkeit nach der nächsten genommen. Wußtet ihr, daß Mäuse sich durch 6,5mm kleine Löcher zwängen können? Das ist ungefähr die Größe eines Bleistifts!!! Mit dem Wissen war ich ihr aber auf der Spur. Das ein oder andere Mal sah ich sie, wie sie ihr Näschen rausgehalten hat, zB hinter meinem Kühlschrank. Dadurch hat sie mich auf ihre Fluchtwege und Verstecke aufmerksam gemacht. Ich habe ihr außerdem jede Nahrungsquelle entfernt, damit hier zu wohnen noch unattraktiver wird. Aber Mäuse sind ja erfinderisch: Sie hat dann einfach meine Verpackungschips geknurpselt, die sind nämlich auf Reisbasis 😂 Ansonsten lieben Mäuse Erdnussbutter hab ich gelesen. Das wäre eigentlich auch ein Leckerli für die Falle, die kläglich mit Schokolade gescheitert ist. Ich hoffte natürlich, sie würde endlich in meine Schokoladenfalle gehen, aber nix da. Statt dessen flitzte sie in meiner Wohnung herum und ich bin dann hinterher. Besonders witzig war, als ich sie im kleinen Flur erwischte. Sie sprintete an mir vorbei, um an der nächsten Ecke abzubiegen, und schlitterte in der Kurve über das Parkett weg und rutschte über den Boden um anschliessend mit den kleinen Beinchen wieder Grip zu kriegen und das Weite zu suchen. Ich hab mich so ziemlich weggeschmissen vor Lachen. Kam mir fast vor, wie in einem Tom&Jerry Film 😂 Im Prinzip lief die ganze Nacht so. Sie kraspelte und machte sich bemerkbar, dann sah ich sie kurz, sie versteckte sich und ich hab hinter ihr jeden Schlitz und jedes Loch dicht gemacht. Jetzt steckt sie gerade im Flur fest und sitzt in den Wänden. Ab und zu läuft sie die Wand hoch und plumpst wieder herunter, was auch ziemlich lustig klingt. Ein Loch habe ich ihr nun gezielt geöffnet, die Haustür aufgemacht und den Flur verbarrikadiert. Ich hoffe, sie flitzt irgendwann raus. Aber schnell bitte, ich bekomme gerade kalte Füße!! .... Tick tack... so, halbe Stunde um. Mir ist kalt und ich bin müde. Super, 6.30h. Schlaflose Nacht dank Mini Mouse. Ich stopfe das Loch wieder zu. Nachher mache ich einen neuen Versuch... aber jetzt erstmal Schlafen. Vielleicht geht das ab diesem Zeitpunkt ja besser, denn ich weiß ja, wo sie ist: in einer ziemlich großen Mausefalle... Euer Waldmädchen

Ein neues Vögelchen in meinem Waldgarten ist die Tannenmeise (Periparus ater) aus der Ordnung der Sperlingsvögel. (Kleine Namenkunde: Der Gattungsname "Periparus" ist übrigens zusammengesetzt aus dem altgriechischen Wort περι (peri), was "ringsum", "umgebend" bedeutet und parus, dem lateinischen Ausdruck für „ Meise“. Das Artepitheton "ater" ist lateinisch und bedeutet "schwarz" oder "dunkel" und ist ein Hinweis auf die dunkle Gefiederfärbung dieser Vögel.) Ich bin ja großer Meisenfan. Sie sind klein, flink und lassen ihre Beobachter doch recht nahe an sich heran. Ihr Federkleid ist prachtvoll in den Farben. Ein bisschen frech sehen sie aus. Die Tannenmeise zählt mit ihren knapp 11cm zu den kleineren Meisenarten. Größe und Gestalt entsprechen in etwa der Blaumeise, weshalb Tannenmeisen auch gelegentlich deren Nistkästen beziehen. Im Prinzip ist die Tannenmeise fast eine Miniaturausgabe der Kohlmeise, da sie ein schwarzes Köpfchen hat. Allerdings hat sie im Unterschied einen weißen Fleck auf dem Hinterkopf und eine eher cremefarbene Brust. Tannenmeisen sind in allen Teilen Deutschlands verbreitet. Von Westeuropa bis Afrika und Japan wird man sie in Wäldern und Gebirgen finden. Sie bewohnen, wie der Name schon sagt, hauptsächliche Nadelbäume. Fichten-, Tannen- und Mischwälder, aber auch Parks, Gärten und Friedhöfe mit Nadelbaumgruppen sind ihr Zuhause. Als Standvögel leben sie das ganze Jahr über bei uns. Im Winter kommt oft zusätzlicher Besuch aus Skandinavien, weshalb die Tannenmeise dann auch an Winterfutterplätzen auffällt. Am liebsten picken sie Insekten und deren Larven. Im Winter bilden Fichtensamen ihre Hauptnahrung. Von Eichhörnchen geöffnete Zapfen oder verlorene Samen bieten zusätzlichen Zugang zu dieser Nahrungsquelle. Gerne verstecken Tannenmeisen die Samen auch für den späteren Verzehr zwischen den Nadeln. Als die kleinste unter unseren Meisen nutzt sie dazu auch die äußersten dünnen Zweige, an die kaum ein anderer Vogel herankommt. Hier ist sie oft rastlos und nach unten hängend unterwegs, was ihr durch zangenartig schließende Krallen möglich ist. Tannenmeisen trinken auch gerne Wassertropfen von den Zweigen und baden sogar im Schnee. Niedlich oder? Ihr Status gilt derzeit als ungefährdet. Euer Waldmädchen